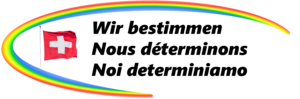Eidg. Volksinitiative »Für eine volksorientierte Politik (No Lobbying)«
'Für eine volksorientierte Politik (No Lobbying)'
Eidgenössische Volksinitiative
Die eidgenössische Volksinitiative «Für eine volksorientierte Politik (No Lobbying)» zielt darauf ab, den Einfluss von Lobbying auf die Schweizer Politik zu reduzieren und die Transparenz sowie Unabhängigkeit der politischen Entscheidungsfindung zu stärken.
Kernanliegen der Initiative:
1. Einschränkung von Interessenbindungen in Kommissionen
Mitglieder der Bundesversammlung, die über erhebliche wirtschaftliche oder politische Interessenbindungen verfügen, sollen nicht in Kommissionen tätig sein dürfen, deren Zuständigkeitsbereich mit diesen Interessen in Zusammenhang steht.
2. Ausstandspflicht bei Interessenkonflikten
Solche Mitglieder müssen sich in den Räten und Kommissionen bei Debatten und Entscheidungen zu Themen, die ihre Interessenbindungen betreffen, der Stimme enthalten.
3. Deklaration von Interessenbindungen und Vergütungen
Die Art und der Umfang der Interessenbindungen sowie erhaltene Honorare oder andere geldwerte Leistungen sind in einem öffentlichen Register offenzulegen.
4. Unabhängige Gesetzgebung
Die Ausarbeitung von Gesetzen und Verordnungen soll intern durch die Verwaltung erfolgen, ohne die Mitwirkung externer Dritter, um externe Einflussnahmen zu vermeiden.
Die Initiative wurde am 11. März 2025 im Bundesblatt veröffentlicht, und die Sammelfrist für Unterschriften läuft bis zum 25. September 2026.
Schutz vor Interessenkonflikten
- Politiker mit finanziellen oder beruflichen Verbindungen zu bestimmten Branchen könnten in Gesetzgebungsprozesse verwickelt sein, die ihre eigenen Interessen begünstigen. Die Initiative will dem entgegenwirken und echte Unabhängigkeit fördern.
Mehr Vertrauen in die Politik
- Wenn Bürgerinnen und Bürger sehen, dass Volksvertreter unabhängig entscheiden und nicht von mächtigen Lobbys gelenkt werden, steigt das Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen.
Gleich lange Spiesse für alle
- Derzeit haben wirtschaftlich starke Akteure oft privilegierten Zugang zu Entscheidungsprozessen. Die Initiative will faire Bedingungen schaffen, damit auch weniger einflussreiche Gruppen Gehör finden.
Transparenz schafft Verantwortlichkeit
- Die Offenlegung von Vergütungen und Interessenbindungen macht politische Entscheide nachvollziehbar und ermöglicht es der Öffentlichkeit, Einflussnahmen zu erkennen und zu bewerten.
Demokratie statt Schattenpolitik
- Lobbyarbeit geschieht häufig im Verborgenen. Die Initiative setzt sich für eine Politik ein, die sich offen am Volkswillen orientiert – nicht an verdeckten Absprachen mit wirtschaftlichen Akteuren.
Stärkung der Gewaltentrennung
- Wenn externe Akteure an der Gesetzgebung mitwirken, verschwimmen die Grenzen zwischen Legislative, Exekutive und Interessenvertretung. Die Initiative will diese Trennung wieder klarer gestalten.
Einschränkung der demokratischen Mitwirkung
- Parlamentarier bringen oft wichtiges Fachwissen aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Gesundheit oder Recht mit. Wenn sie aufgrund von Interessenbindungen ausgeschlossen werden, geht wertvolle Expertise verloren.
Schwächung des Milizsystems
- Die Schweiz lebt vom Milizparlament – viele Parlamentarier üben ihre politischen Ämter nebenberuflich aus. Die Initiative könnte dazu führen, dass Berufstätige aus gewissen Branchen kaum mehr politisch tätig sein dürfen.
Ausgrenzung statt Transparenz
- Bereits heute gibt es Transparenzpflichten. Kritiker meinen: Statt bessere Regeln zur Offenlegung zu schaffen, verbietet die Initiative Beteiligung – das sei undemokratisch und übertrieben.
Rechtsunsicherheit und Bürokratie
- Wer entscheidet, wann eine Interessenbindung "erheblich" ist? Und wann jemand in den Ausstand muss? Die Initiative könnte komplizierte rechtliche Fragen aufwerfen und den politischen Alltag erschweren.
Pauschales Misstrauen gegenüber Politikern
- Die Initiative vermittelt die Haltung, dass Politikerinnen und Politiker generell käuflich oder beeinflussbar seien. Das wird dem grossen persönlichen Engagement vieler Parlamentarier nicht gerecht.
Lobbyismus ist nicht per se schlecht
- Interessenvertretung gehört zu einer funktionierenden Demokratie: Auch Gewerkschaften, NGOs oder Umweltorganisationen lobbyieren. Ein totales Misstrauen gegenüber allen Formen von Einflussnahme könnte den demokratischen Diskurs schwächen.
Text der Verfassungsänderung
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 161 Abs. 3–6
3 Mitglieder der Bundesversammlung mit ausgewiesenen wirtschaftlichen oder politischen Interessenbindungen dürfen nicht in Kommissionen Einsitz nehmen, deren Zuständigkeitsbereich einen Zusammenhang mit den betreffenden Interessen hat.
4 Mitglieder der Bundesversammlung mit ausgewiesenen wirtschaftlichen oder politischen Interessenbindungen treten in den Räten und Kommissionen bei Debatten in den Ausstand, die Themen behandeln, die einen Zusammenhang mit den betreffenden Interessen haben.
5 Art und Umfang der Interessenbindungen sowie Honorar oder andere geldwerte Leistungen sind in einem Register zu deklarieren.
6 Die Erarbeitung von Gesetzen und Verordnungen erfolgt verwaltungsintern und ohne Mithilfe Dritter.
Art. 197 Ziff. 172
17. Übergangsbestimmung zu Art. 161 Abs. 3–6 (Instruktionsverbot)
Die Bundesversammlung erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 161 Absätze 3–6 spätestens ein Jahr nach dessen Annahme durch Volk und Stände.
1 SR 101
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt.
Diese Initiative wurde lanciert von folgenden Komitee-Mitgliedern (nach Alphabet Nachname):

Hauri Andreas

Hauri-Meier Doris Elisabeth

Müller Ernst

Rigert Margrit

Schwizer Elisabeth

Schwizer Elsbeth

Schwizer Marie Louise

Schwizer Roland

Triebold Urs

Wechsler Jeanette

Wechsler Josef
Dieses Referendum wird von folgenden Organisationen unterstützt:
Medien
(Es werden nur Artikel veröffentlicht, welche nicht hinter einer Bezahlschranke und per Link aufrufbar sind.)